UVP + SUP Vertiefung: Vollständigkeitsprüfung – Sicherstellung der Qualität des UVP-/ Umweltberichts
Die Qualität der Fachgutachten in den Verfahren der Umwelt-prüfungen – der UVP-Bericht und der Umweltbericht als zentrale Bestandteile der Antragsunterlagen prüfpflichtiger Vorhaben – ist von hoher Bedeutung für die Qualität des Zulassungs- bzw. Planungsverfahrens. Die UVP-Richtlinie 2014/52/EU weist einleitend in den Erwägungsgründen 30 bis 33 ausdrücklich darauf hin. Artikel 5 Abs. 3 der UVP-RL fordert kompetente Fachleute und Personal sowohl auf Seiten der Behörden, die für die Prüfung des Berichts zuständig sind, als auch des Projektträgers, der für die Erstellung des UVP-Berichts verantwortlich ist. Unzureichende, nicht umfassend qualitätsgesicherte UVP-Berichte als Grundlage für die Öffentlichkeitsbeteiligung führen in der Regel zu unbefriedigenden und konfliktreichen Erörterungsterminen. In der Praxis werden zwar bei großen Infrastrukturvorhaben teilweise externe Qualitätssicherer eingesetzt, eine regelhafte Beteiligung solcher nicht interessengebundener Akteure ist jedoch eher die Ausnahme. Weitere Faktoren für eine gute Qualität der Berichte stellen ein effektives Scopingverfahren und eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung (z.B. im Sinne des § 25 Abs. 3 VerwVfG) dar.
Auch die SUP-Richtlinie 2001/42/EG verlangt die Sicherstellung der Qualität der Umweltberichte in Artikel 12 Absatz 2 und erläutert deren Notwendigkeit in den Erwägungsgründen. Ein umfassendes F+E Vorhaben zur Evaluation der Praxis der SUP in Deutschland hat sich unter anderem mit der Qualität der Umweltberichte auseinandergesetzt. Im Seminar werden wesentliche Erkenntnisse daraus präsentiert, ergänzt um weitere Fallbeispiele. Die Praxis der SUP ist weitgehend mit den gleichen Herausforderungen konfrontiert wie die UVP. Jedoch gibt es aufgrund von verschiedenen Detaillierungsgraden und anderen Zuständigkeiten auch Unterschiede.
Im Seminar werden neben den Erkenntnissen aus der empirischen Forschung praxisorientierte Instrumente und Methoden der Qualitätssicherung vorgestellt, die zu einer guten fachlichen Praxis der Berichte beitragen können. Ein weiterer Schwerpunkt nimmt die Darstellung von Fallbeispielen ein. Negative und positive Fallstudien sollen verdeutlichen, wo in der Praxis häufig Schwachstellen identifiziert werden können. Neben unzureichenden Bestandserhebungen sind es häufig auch die Bewertungen der prognostizierten Umweltauswirkungen im Rahmen von Alternativenvergleichen, die einen wesentlichen Konfliktbereich darstellen. Auch die rechtlichen Anforderungen an Inhalte und Methoden der Berichte werden im Seminar behandelt. Der Fokus liegt dabei auf der Perspektive der verfahrensführenden/ planaufstellenden Behörde.

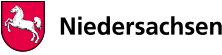

 Englisch
Englisch